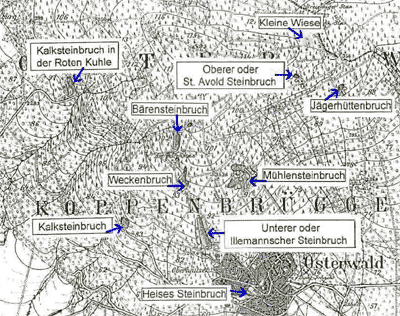Der Beginn der Nutzung der Steinbrüche im Osterwald liegt spätestens im frühen 15. Jahrhundert. So bezog zum Beispiel die Stadt Hildesheim 1402 die Steine für ihre Kanonenkugeln aus dem Osterwald, wenn auch aus den direkt benachbarten Mehler Steinbrüchen. Für das Osterwalder Gebiet lässt sich ein ähnlich früher Nutzungsbeginn vermuten, obwohl genaue Daten hier erst ab 1770 vorliegen.
Seit dem 19. Jahrhundert wurden in Osterwald vor allem Mühlensteine, Mauersteine, Platten für Bürgersteige und Steine für Untergrundmauerungen von Brücken und Kanälen gebrochen. Die Nachfrage nach Steinen stieg in den 1880er Jahren nochmals stark an, als die Verwendbarkeit des Wealdensandsteins für Pflaster- und Bordsteine entdeckt wurde.
Viele Steinbrüche verfügten über Brems- und/oder Pferdebahnen, mit denen die Steine zu Tal, zum Beispiel zum Bahnhof Osterwald, transportiert wurden. In jedem Steinbruch lag ein Haus, das zugleich als Aufenthaltsraum, Schmiede und Raum für den Polier diente.
In Osterwald liegen Kalk- und Sandsteinbrüche dicht beieinander. Während am Fusse des Südhanges die Kalksteinbrüche liegen, sind die Sandsteinbrüche höher am Berg zu finden.
* Rote Kuhle: Beginn des Kalksteinabbaus war 1804; der Steinbruch lieferte die Steine für den Wegebau des Amtes Lauenstein; der Name „Rote Kuhle“ entstand durch Fund von rotem Mergel; Nutzungsende ca. 1936.
* Hohewarter Kalksteinbruch: auch Steinbruch im Moorgrund genannt, wurde im 19. Jahrhundert als Kalksteinbruch genutzt.
* Heises Steinbruch: wurde um 1850 als Kalksteinbruch genutzt.
* Bärensteinbruch: wurde als großer Steinbruch von der Bergwerksgesellschaft angelegt, vermutlich im 19. Jahrhundert; Stillegung bereits vor 1. Weltkrieg; Wiederinbetriebnahme ab 1933 durch Wilhelm Brand; bis 1934 als Sandsteinbruch genutzt.
* Jägerhüttensteinbruch: wurde im 19. Jahrhundert als Sandsteinbruch genutzt; war ein Betrieb von Meine und Illemann – das bedeutendste Steinbruchunternehmen von 1872 – 1935.
* Kleine Wiese-Steinbruch: wurde von 1933 – 1935 als Sandsteinbruch genutzt.
* Mühlensteinbruch: angelegt durch die Bergwerksverwaltung; um 1870 wurde eine Bremsbahn gebaut, die ab 1889 (im unteren Teil als Pferdebahn) zum Osterwalder Bahnhof weiterführte. Vornehmlich für den Steinkohletransport des Bergwerks bestimmt, wurde sie nach der Jahrhundertwende auch für den Steintransport benutzt. In der Folge hatte der Steinbruch mehrere Besitzer, unter anderem die Firma Meine und Illemann (ab 1905) und die hannoversche Straßenbaufirma Gebrüder Schröder (1924 – 1931). Aus dem Steinbruch entnahm die Glashütte auf der Sümpelbreite Steine zur Herstellung von Quarzsand. Außerdem wurden von hier Steine für die Terrassen der Maschsee-Gaststätte in Hannover und das Kaufhaus Lindemann in Hildesheim geliefert. 1965 übernahm Wilhelm Schmull den Steinbruch. Das Stilllegungsdatum ist unbekannt.
* Oberer oder St. Avold Steinbruch: um 1900 von Mauermeister Wilhelm Jung erschlossen. Er bekam den Beinamen St. Avold oder „Sanktivol“ in Anspielung auf die Entfernung der Garnisonstadt St. Avold in Lothringen von Osterwald, weil der Steinbruch so weit von Osterwald entfernt lag, dass die Arbeiter teilweise im Steinbruch übernachteten. 1924 erfolgte die Übernahme des Steinbruchs von der hannoverschen Straßenbaufirma Gebrüder Schröder; bis 1964 als Sandsteinbruch genutzt, heute Naturschutzgebiet.
* Unterer oder Illemannscher Steinbruch: vom 19. Jahrhundert an bis 1920 genutzt als Sandsteinbruch. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bis zum I. Weltkrieg von Meine und Illemann gepachtet. Große Mengen Rohsteine wurden exportiert : zum Beispiel wurde die Marienburg zu Nordstemmen, der Hansabrunnen und diverse Banken in Hamburg aus Steinen der Illemannschen Brüche gebaut.
* Weckenbruch: vom 19. Jahrhundert bis 1936 als Sandsteinbruch genutzt.
Die Steinbrüche zeigen die typischen Zustände der Verwilderung, d.h., zwischen den Steinblöcken wachsen wilde Gehölze, oft viele Jahrzehnte alt. In manchen Senken hat sich Wasser gesammelt; der St. Avold-Steinbruch ist heute sogar ein See.

Die Fundamente der Bremse und die Bremsbahnschneise des Mühlensteinbruch (Foto: Wiegand, 2002, HM-XXIX-2)
Die Bedeutung der Osterwalder Steinbrüche liegt darin, dass sie so zahlreich sind. Zusammen mit den unzähligen Bergbaurelikten (in der Regel Halden) tragen sie zum besonderen Erscheinungsbild des Osterwaldes bei, das durch die allgegenwärtigen Spuren des historischen Lagerstättenabbaus geprägt ist.
Die Steinbrüche liegen an Forstwegen, sind also gut erreichbar. Der St. Avold-Steinbruch darf nicht betreten werden (Naturschutzgebiet), ist aber von einem Aussichtspunkt aus gut zu übersehen.