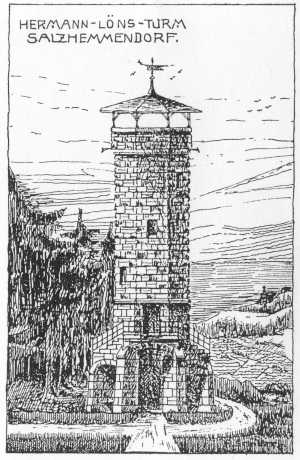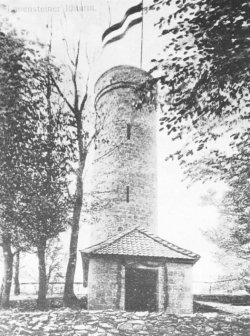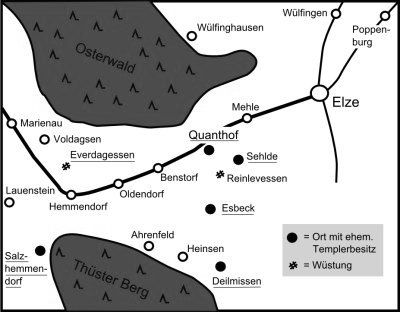| M. Burchard | 1689 | Die Kopfsteuerbeschreibung des Fürstentums Calenberg-Göttingen und Grubenhagen |
| Daniel Eberhard Baring | 1744 | Beschreibung der Saale im Amt Lauenstein („Saalechronik“) |
| W.A. Rudorff | 1858 | Das Amt Lauenstein, Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen |
| F. Meissel | 1887 | Der Kreis Hameln, Beschreibung, Geschichte und Sage |
| G. Schnath | 1922 | Die Herrschaften Everstein, Homburg und Spiegelberg Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hannover, Heft 7 |
| S. Freydank | 1929 | Die Bedeutung der Ortsnamen des Kreises Hameln-Pyrmont |
| Wilheln Barner | 1931 | Unsere Heimat – Das Land zwischen Hildesheimer Wald und Ith |
| W. Seidensticker | 1938 | Chronik von Salzhemmendorf |
| Kurt Brüning | 1952 | Der Landkreis Hameln-Pyrmont |
| R. Feige | 1961 | Heimatchronik der Stadt Hameln und des Landkreises Hameln-Pyrmont |
| 1968 | 900 Jahre Wallensen | |
| Herbert Six | 1972 | 950 Jahre Salzhemmendorf |
| Ulrich Baum | 1972 | Lauenstein Aus Sage und Geschichte |
| 1972 | 950 Jahre Salzhemmendorf 1022-1972 | |
| Ulrich Baum | 1976 | Heiteres und Besinnliches aus Lauenstein |
| 1991 | 750 Jahre Benstorf | |
| 1993 | Chronik Levedagsen | |
| Meinhard Döpner | 1996 | Steinbruch- und Bergwerksbahnen zwischen Osterwald und Ith |
| 1997 | 800 Jahre Ahrenfeld – Eine Dorfgeschichte von 1197-1997 | |
| 1997 | 1000 Jahre Hemmendorf | |
| 1997 | 750 Jahre Lauenstein | |
| Adolf von Einem | Oldendorf und seine Höfe | |
| Frau Pluns | Sitten und Gebräuche in Osterwald, Alte Überlieferungen | |
| Hans Dieter Kreft | Eine kleine Geschichte des Bergortes in Stichpunkten (Osterwald) | |
| Hans Dieter Kreft | Auf den Spuren der industriellen Vergangenheit (Osterwald) | |
| Feldmann / Kraus | Zwischen Hils und Osterwald – Ein historisch geologischer Freizeitführer | |
| Die Chronik der Gemeinde Thüste | ||
| Molkerei-Genossenschaft Wallensen 1897-1957 | ||
| Ulrich Baum | Ithland – Sagenland / Ein kleiner Ortsführer / Lauenstein am Ith in alten Ansichten | |
| Wilhelm Barner HOIKE | Sagen und Erzählungen aus dem Land zwischen Hildesheimer Wald und Ith |